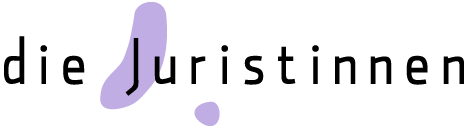Die Petition fordert die Normierung zusätzlicher Bedingungen für den Zugang zu (legalen) Schwangerschaftsabbrüchen. Das deklarierte Ziel „sozialer und gesetzlicher Verbesserungen bei Konfliktschwangerschaften“ kann damit mit Sicherheit nicht erreicht werden. Stattdessen würde der Zugang zu legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen für Frauen* (weiter) erschwert und ihre Gesundheit und Selbstbestimmung gefährdet. Und auch das angegebene Ziel, ein „Ende der Diskriminierung von Kindern mit Behinderung“ herbeizuführen, ist mit der Abschaffung der sogenannten embryopathischen Indikation keinesfalls zu erreichen. Stattdessen würde die Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen steigen, weil die Zeit für eine umfassende medizinische Abklärung und Beratung im Rahmen der Fristenregelung fehlt. Die Petition ist daher in ihrer Gesamtheit abzulehnen.
Der Verein DIE JURISTINNEN nimmt die vorliegende Petition jedoch zum Anlass, um im Sinne der Gesundheit und Selbstbestimmung von schwangeren Frauen* erneut die aufgrund der
menschenrechtlichen Verpflichtungen Österreichs längst überfällige Streichung des
Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch zu fordern.
Zur aktuellen Situation des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich
Schwangerschaftsabbrüche stehen in Österreich gemäß § 96 Strafgesetzbuch (StGB) grundsätzlich unter gerichtlicher Strafe und sind nur in bestimmten, gesetzlich geregelten Ausnahmefällen nach § 97 StGB (sog. Fristen- und Indikationenlösung) straffrei. Dies stellt eine Verletzung des (reproduktiven) Selbstbestimmungs- rechts von Frauen* dar und kriminalisiert das berechtigte Interesse von Frauen* selbst über ihr Leben zu bestimmen.
Darüber hinaus gestaltet sich der Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen in der Praxis äußerst schwierig. Immer noch müssen die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen Kosten des Eingriffs von den Frauen* privat bezahlt werden, weil die Krankenkassen sie nicht übernehmen. Hinzukommt, dass der Zugang zu Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche in Österreich durchführen, nicht flächendeckend gewährleistet ist.
Zu den internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen Österreichs
Die Position des Vereins DIE JURISTINNEN stützt sich im Kern auf die Vorgaben einer Reihe internationaler menschenrechtlicher Übereinkommen, die von Österreich ratifiziert wurden und umzusetzen sind, darunter die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) und die UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK).
Weil Schwangerschaftsabbrüche eine medizinsche Leistung sind, die nur Frauen* benötigen, haben Vertragsüberwachungsorgane, die die Einhaltung dieser Übereinkommen kontrollieren, immer wieder festgehalten, dass der (niederschwellige) Zugang dazu für die Schaffung von Geschlechtergleichheit unerlässlich ist. Die Verweigerung oder Erschwerung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen gefährdet die reproduktive Autonomie von Frauen* und (kann) eine Reihe von Grundrechten verletzen – wie ua das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Leben, das Recht auf Privatsphäre, das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und das Verbot unmenschlicher Behandlung.
Das Grundrecht, selbstbestimmt über den eigenen Körper zu entscheiden, ist nach herrschender Lehre Teil der in Artikel 8 EMRK geschützten Privatsphäre. Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis zur Verfassungswidrigkeit des Ausschlusses von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften von Frauen* vom Zugang zu künstlicher Befruchtung 20133 festgehalten, dass die Entscheidung über den Kinderwunsch als Teil des Privatlebens vom Schutzbereich des Artikel 8 EMRK umfasst ist. Das beinhaltet auch die Freiheit, sich für den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden.
Die Verfassungsmäßigkeit der in § 97 Abs 1 Z 1 StGB normierten Fristenlösung wurde vom VfGH zudem bereits 1974 festgestellt:
„Da das werdende menschliche Leben im Zustand der ‚Frucht im Mutterleib‘ eine Entwicklung durchmacht, die von der eines Lebens außerhalb des Mutterleibes unter natürlichen Bedingungen unfähigen befruchteten Eizelle bis zu dem außerhalb des Mutterleibes lebensfähigen Menschen reicht, sind diese verschiedenen Entwicklungsphasen der biologischen Einheit ‚Frucht im Mutterleib‘ nicht notwendig ein Gleiches im Sinne des verfassungsgesetzlich verankerten Gleichheitssatzes.“
Bei einer Gesamtbetrachtung des in Artikel 2 EMRK gewährleisteten Schutz des Lebens ist das ungeborene Leben also nicht erfasst. Die Grundrechtsträgerschaft beginnt erst mit der Geburt. Das ungeborene Kind kann sich deshalb nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen nach Artikel 7 Abs 1 S 3 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) berufen. Die Regelungen über den Schwangerschaftsabbruch unterscheiden zwischen Föten mit und ohne Behinderung. Eine solche rechtliche Ungleichbehandlung verbietet der Gleichheitsgrundsatz und ist nur bei einer sachlichen Rechtfertigung zulässig. Eine solche kann in der Situation der Eltern bzw in den allermeisten Fällen der Mutter liegen. Für sie bringt die Erziehung und Betreuung eines Kindes mit Behinderung zweifelsfrei größere Herausforderungen mit sich als jene von Kindern ohne Behinderung. Die Betreuung eines schwerstbehinderten Kindes birgt für eine alleinerziehende Mutter zudem ein erhöhtes Armutsrisiko, wenn diese zur Erlangung eines gesicherten Lebensunterhalts auf eine berufliche Tätigkeit angewiesen ist, die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten dies aber unmöglich machen. Dazu aus dem Gutachten der Rechtswissenschaftliche Fakultät Innsbruck über die aus dem UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erwachsenden Verpflichtungen Österreichs:
„Anstatt einer Verschärfung des strafrechtlichen Rahmens braucht es vielmehr staatliche Fördermaßnahmen, um Eltern die Angst vor der Erziehung von behinderten Kindern zu nehmen, und diese auch dabei zu begleiten.“
Die im Zusammenhang mit dem Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen relevanten Bestimmungen der CEDAW finden sich insbesondere in Artikel 2 lit g CEDAW, wonach sich die Vertragsstaaten zum Zweck der Beseitigung der Diskriminierung der Frau* verpflichten, alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine Diskriminierung der Frau*darstellen, und in Artikel 12 CEDAW, wonach die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau* im Bereich des Gesundheitswesens treffen, um der Frau* gleichberechtigt mit dem Mann* Zugang zu den Gesundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Familienplanung, zu gewährleisten. Nach Absatz 2 haben die Vertragsstaaten darüber hinaus für angemessene und erforderlichenfalls unentgeltliche Betreuung der Frau* während der Schwangerschaft sowie während und nach der Entbindung und für die ausreichende Ernährung während der Schwangerschaft und der Stillzeit zu sorgen. In den rechtsverbindlichen und von Österreich umzusetzenden Abschließenden Bemerkungen des CEDAW-Komitees zu Österreich wurde der mangelhafte Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bereits mehrmals gerügt:
In den Abschließenden Bemerkungen Nr. 38 und Nr. 39 zum kombinierten 7. und 8. periodischen Staatenbericht Österreichs hegt das Komitee Bedenken, weil Schwangerschaftsabbrüche, wenngleich legal vorgenommen, von der Krankenversicherung nicht vergütet werden und Daten über die Auswirkungen auf wirtschaftlich, schlechter gestellte Frauen* und Mädchen* fehlen. Zudem ist das Komitee über den Mangel an Informationen über die Folgen der Finanzkrise und der Sparmaßnahmen für die gesundheitliche Versorgung von Frauen besorgt und befürchtet, dass die Qualität der medizinischen Versorgung von Frauen* bei einer Privatisierung sinken könnte. Es empfiehlt daher, wirtschaftlich benachteiligte Frauen* und Mädchen*, finanziell zu unterstützen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch benötigen, sich diesen aber nicht leisten können.
Im Zusammenhang mit der von der vorliegenden Petition geforderten verpflichtenden „Bedenkzeit“ vor der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs ist auf die Abschließende Bemerkung Nr. 37 zum kombinierten 7. und 8. Staatenbericht Deutschlands hinzuweisen. Die in Deutschland verpflichtende mindestens dreitägige Wartepflicht wird darin gerügt. Konkret äußert das Komitee seine Besorgnis über:
„37. (b) die Tatsache, dass gemäß Paragraph 218 (a) (1) des Strafgesetzbuchs Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch auf eigenes Verlangen wünschen, eine verpflichtende Beratung in Anspruch nehmen und eine vorgeschriebene Wartezeit von drei Tagen (welche die WHO als medizinisch nicht erforderlich erklärt hat) einhalten müssen, sowie über die Tatsache, dass die Krankenversicherung in solchen Fällen die Kosten des Schwangerschaftsabbruchs nicht trägt (obwohl in Sonderfällen und nach einer Bedürftigkeitsprüfung die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz übernommen werden können)“ .
In seiner 1999 veröffentlichten Allgemeinen Empfehlung Nr. 24 hielt das Komitee zudem fest, dass Gesetze, die den Schwangerschaftsabbruch kriminalisieren, möglichst geändert werden sollten, um Strafmaßnahmen gegen Frauen zu verhindern, die sich einem Schwangerschaftsabbruch unterziehen:
„When possible, legislation criminalizing abortion should be amended, in order to withdraw punitive measures imposed on women who undergo abortion.“
Darüber hinaus hat das Komitee 2017 in der aktualisierten Allgemeinen Empfehlung Nr. 35 zu Gewalt gegen Frauen abermals gefordert, Gesetze, die Schwangerschaftsabbrüche kriminalisieren, aufzuheben und klargestellt, dass die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bzw deren Verweigerung oder Verzögerung eine Verletzung der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsrechte von Frauen* sowie geschlechtsspezifische Gewalt im Sinne der CEDAW-Konvention ist, die je nach den konkreten Umständen als grausame oder unmenschliche Behandlung bzw Folter einzustufen ist:
„18. Violations of women’s sexual and reproductive health and rights, such as forced sterilization, forced abortion, forced pregnancy, criminalization of abortion, denial or delay of safe abortion and/or post-abortion care, forced continuation of pregnancy, and abuse and mistreatment of women and girls seeking sexual and reproductive health information, goods and services, are forms of gender-based violence that, depending on the circumstances, may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment.“
Österreich wird im Juli 2019 das nächste Mal durch das Komitee auf die Einhaltung der CEDAW überprüft. Sollte es zu einer Einschränkung des Zugangs zu legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen kommen, ist davon auszugehen, dass Österreich gerügt wird und das Komitee aussprechen wird, dass dies mit Österreichs Verpflichtungen aus der Konvention unvereinbar ist.
Schließlich ist im Zusammenhang mit der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung von Frauen* mit Behinderungen Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b UN-BRK hervorzuheben. Dieser verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in Fragen der Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaft zu beseitigen. Absatz 1 Buchstabe b schützt das Recht von Menschen mit Behinderungen autonom, selbstbestimmt und frei von staatlicher Bevormundung entscheiden zu können, ob, wie viele, und in welchem zeitlichen Abstand sie Kinder bekommen wollen. Zur Verwirklichung dieser Entscheidungsfreiheit wird zudem das Recht auf Zugang zu altersgemäßer Information und Aufklärung normiert.
Die Position des Vereins DIE JURISTINNEN
Zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen*
Gesetzliche Regelungen über Schwangerschaftsabbrüche müssen zuallererst das Recht von Frauen* auf Selbstbestimmung gewährleisten. Dazu gehört im Rahmen der Entscheidung über einen Kinderwunsch auch die Freiheit, sich selbstbestimmt für den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden. Einschränkungen der geltenden Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch, wie von der vorliegenden Petition gefordert, würden Frauen*, die einen Abbruch benötigen, in die Illegalität treiben und sind mit den verpflichtenden menschenrechtlichen Vorgaben unvereinbar. Tatsächlich stellt schon die österreichische Fristen- und Indikationslösung im Strafgesetzbuch eine Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts von Frauen* dar. Der Verein DIE JURISTINNEN fordert daher die ersatzlose Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch.
Der österreichische Staat hat die Verpflichtung, den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen durch entsprechende (gesetzliche) Regelungen und Maßnahmen zu garantieren, um eine Gefährdung von Gesundheit und Leben der Frauen* durch illegal durchgeführte Abbrüche auszuschließen. Die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs sollte daher – wie medizinsche Eingriffe im Allgemeinen – im Medizinrecht verankert werden. Der Zugang zu einem sicheren Abbruch ist Frauen* weder durch Fristen noch durch andere gesetzliche Beschränkungen zu erschweren oder gar zu verwehren. Der Eingriff ist wie jede andere medizinische Versorgung zu behandeln, die sich zwischen Patientin und Ärzt*in abspielt. Wenn die Frau* es möchte, schließt das Beratung und psychologische Betreuung nicht aus. Dazu Jula Hughes, Professorin für Strafrecht an der Universität New Brunswick in Kanada, wo der Schwangerschaftsabbruch bereits 1988 aus dem Strafgesetz genommen wurde:
„Eine spezielle Regelung des Abbruchs im Strafrecht ist nicht nur kontraproduktiv, es gibt auch keinen vernünftigen Grund, den Abbruch gesundheitsrechtlich besonders zu regeln. Die Chance, dass eine Patientin beim Abbruch zu Schaden kommt, ist unter Strafandrohung wesentlich höher. Die ersatzlose Streichung erleichtert gerade in Krisensituationen die Beratung und Behandlung von Patientinnen, wie die kanadische Erfahrung gezeigt hat. Die Entkriminalisierung des Abbruchs trägt zur Gleichstellung von Frauen bei, ohne dabei Regelungsprobleme im Gesundheitswesen auszulösen.“
Um den Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen in der Praxis auch tatsächlich zu gewährleisten, braucht es Kostenersatzregelungen, dh die Übernahme der Kosten für Schwangerschaftsabbrüche durch die Krankenkassen, (finanzielle) Unterstützung für nicht krankenversicherte Frauen* und die Verpflichtung von öffentlichen Krankenanstalten zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen.
Damit in Zukunft nur wenige Frauen vor der Entscheidung stehen, einen Abbruch vorzunehmen, müssen von staatlicher Seite zudem vermehrt Maßnahmen gesetzt werden, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Dazu zählen neben der Schaffung eines flächendeckenden Zugangs zu kostenfreien Verhütungsmitteln der Ausbau des Sexualkundeunterrichts an Schulen und die ausreichende Finanzierung von psychosozialen Beratungsangeboten, in denen ergebnisoffene, anonyme und kostenfreie Beratungsgespräche zu Sexualität, Geschlechtsidentität, Verhütung, Schwangerschaftskonflikten und Schwangerschaftsabbrüchen in Anspruch genommen werden können.
Diese Beratungsgespräche müssen jedoch auf freiwilliger Basis stattfinden und dürfen in Anwendung der Bestimmungen der CEDAW nicht mit verpflichtenden Wartezeiten verbunden werden. Dies würde nicht nur eine unrechtmäßige Bevormundung bedeuten und den Druck auf schwangere Frauen* erhöhen. Verpflichtende Wartezeiten sind medizinisch schlicht nicht notwendig und können im Einzelfall sogar Risiken für die Gesundheit der schwangeren Frau* bedeuten. Sie werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Barriere im Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen eingestuft, da sie medizinische Behandlungen verzögern, und Frauen ihre Kompetenz als eigenverantwortliche Entscheidungsträgerinnen absprechen.
Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
Der Verein DIE JURISTINNEN ist solidarisch mit der Forderung der Behindertenbewegung nach einem selbstbestimmten Leben für Menschen mit Behinderungen. Jede Form der Diskriminierung, ob wegen des Geschlechts, aufgrund einer Behinderung oder aus einem anderen Grund, ist abzulehnen. Die Forderung nach einer Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen darf aber nicht dazu verwendet werden, um das Recht von Frauen* auf Selbstbestimmung einzuschränken. Wir verwehren uns gegen eine Instrumentalisierung der Rechte von Menschen mit Behinderungen durch Abtreibungsgegner*innen.
Auch vor diesem Hintergrund lehnen wir die Abschaffung der embryopathischen Indikation ab. Dadurch würde Frauen* eine mit ihrem Selbstbestimmungsrecht unvereinbare Austragungs- und Gebärpflicht von Kindern mit schwersten Fehlbildungen auferlegt. Zudem käme es zu einer sozialen Diskriminierung, weil Frauen* je nach ihren finanziellen Möglichkeiten, Schwangerschaftsabbrüche zu einem späteren Zeitpunkt im Ausland durchführen lassen würden, oder gezwungen wären, eine Schwangerschaft gegen ihren Willen auszutragen.
Um für Menschen mit Behinderungen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten und einen wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten, braucht es eine Vielzahl staatlicher Maßnahmen der Inklusion, sozialen Sicherung und Infrastruktur im Sinne der UN-BRK. Die Abschaffung der embryopathischen Indikation zählt dazu nicht, denn sie leistet keinen Betrag zu einer inklusiven Gesellschaft, führt nicht zur Abkehr von immer noch vorhandenen, stereotypen Rollenzuschreibungen und wird keinesfalls die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche verringern. Im Gegenteil: Peter Husslein, Leiter der gynäkologischen Abteilung im AKH, weiß, dass sich viele Schwangere, gäbe es keine legale Möglichkeit für einen späteren Abbruch, oftmals für einen Abbruch innerhalb der Drei-Monatsfrist entscheiden würden, wenn erste Untersuchungen auf eine Behinderung des Fötus hinweisen. Und das obwohl die Untersuchungsergebnisse im ersten Drittel der Schwangerschaft noch ungenau sind und sich häufig später als falsch herausstellen. In der Folge würde die Abschaffung der embyopathischen Indikation sogar zu einem starken Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche führen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in der Petition geforderten Massnahmen eine Beschränkung des freien und sicheren Zugangs zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen darstellen. Ihre Umsetzung würde eine menschenrechtswidrige Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts von Frauen* bedeuten. Die Petition ist daher in ihrer Gesamtheit strikt abzulehnen. Vielmehr fordert der Verein DIE JURISTINNEN, dass Österreich seiner Verpflichtung, das reproduktive Selbstbestimmungsrecht von Frauen* umfassend zu gewährleisten, nachkommt.
Stellungnahme zu der Parlamentarischen Bürgerinitative #FAIRÄNDERN (54/BI 24. GP)